Berichte
| Die HyperKult_22 an der Leuphana Universitt in Lneburg
Oktober / November 2013
Leuphana Universitt Lneburg, Hyperkult 22
Es diskutieren Prof. Dr. Martin Warnke, Prof. Dr.
Rolf Gro§mann mit Michael Harenberg
Mit gesprochenen Twitter Tweets als knstlerische
Verdichtungen whrend der Konferenz von Hartmut Srgel.
Zum nachlesen auf Twitter: @HyperKult_XII
http://www.leuphana.de/institute/icam/forschung-projekte/hyperkult/hyperkult-22.html
Titelreihenfolge:
1_Hyperkult_Disk_1, Diskussion Block 1
2_TopoPhonieNr.3, Sabine Schfer, TopoPhonien Nr. 3
3_Hyperkult_Disk_2, Diskussion Block 2
4_Behrens_Heyduck, Plastic/Metal
5_Hyperkult_Disk_3, Diskussion Block 3
6_CodeCruncher_1, Gro§mann, Idensen, Stockhausen,
Harenberg,
7_Hyperkult_Disk_4, Diskussion Block 4
8_CodeCruncher_2, Gro§mann, Idensen, Stockhausen,
Harenberg,
9_Hyperkult_Disk_5, Diskussion Block 5
10_Fiedler/Harenberg, ãDas pythagorische KommaÒ,
11_Hyperkult_Disk_6, Diskussion Block 6
12_StillePost, h-peh ãshellout sessionÒ
zu 1:
HyperKult XXII
Computer als Medium
Standards, Normen, Protokolle
4.-6. Juli 2013
Centre for Digital Cultures
Medien- und Informationszentrum und
Institut fr Kultur und sthetik digitaler Medien
der
Leuphana Universitt Lneburg
veranstaltet von der
Gesellschaft fr Informatik e. V. (GI), FG
"Computer als Medium"
FB Informatik und Gesellschaft
Das Programm des Workshops
Es gibt nichts Langweiligeres unter der Sonne als
Normen und Standards. Protokolle sind etwas fr Royals und angehende Debtanten
des Wiener Opernballs.
Das Internet allerdings funktioniert in seiner
netzneutralen Fassung nur unter der drgen Observanz der Protokolle, die von
den pickligen Jnglingen der Netz-Pubertt noch ber RFC, Request for Comments,
auf dem schchternsten aller Wege zu Stande kamen. Es kam das Internet in die
Welt, als Triumph von TCP/IP, mit zwei mal "P" fr
"Protokoll". Das mochten die Konzernherrn aus Paris, New York, Bonn
nicht gern, mussten sich aber dennoch beugen. So viel zum vorlufigen Sieg der
Graswurzel-Idee des Internet in Form von Normen, Standards und Protokollen. Es
scheint allerdings unklar, ob die Proprietaritt nicht vielleicht doch die
Oberhand gewinnen knnte, und das ganze schne partizipative Internet wre
dahin.
Es wre dann nicht das erste Mal, dass Firmenmacht ber
Normen, Standards und Protokolle gesiegt htte, die in diesem Lichte nun wieder
als die Horte demokratischer Teilhabe und Ergebnisse eines herrschaftsfreien
Diskurses gelten knnten. Selbst beim Datenschutz kann man sich Dank gltiger
Rechtsnormen, einstmals heroisch erstritten, in geregelten europischen Datenhfen
sicherer fhlen als im "safe harbour" Californischer
Datenprozessierer, die die lngste Zeit und schon lange nicht mehr von Hippies
betrieben wurden.
Doch manche Standards sind auch unbestritten extrem
erfolgreich: MIDI, ISO/OSI, DIN und die Bohrung von Colts.
Welche Rolle spielen Standards, Normen und
Protokolle fr die Strukturbildung der Nchsten Gesellschaft? Sind Protokolle
nicht vielleicht doch ihre wichtigsten Medien, und der lange Marsch durch die
Institutionen msste heute durch die Normungskommissionen verlaufen? Welche
Bedeutung haben das W3C, welche die ICANN, die WIPO? Wo, bitteschn, scheint
denn eine neue Anarchie auf, die alle diese verkncherten Regularien,
wenigstens fr kurze Zeit, zum Teufel schickte?
----------------------------------------------------------------------------------------
zu 2:
Sabine Schfer, ãTopoPhonie Nr. 3Ò
Werktitel (Entstehungsjahr): TopoPhonie Nr. 3
(1996)
Dauer: 12 ́30 ́ ́
Anzahl der Kanle / Besetzung: 8 Kanle / 8
Lautsprecher
Gattung: begehbare Raumklanginstallation
Das Werk kann auch konzertant aufgefhrt werden.
Angaben zu den abgespeicherten Spuren /
Audio-Files:
Format: .aif / 16 bit / 44.1 kHz
Anzahl und Gruppierung der Spuren:
Spur 1 – 8: ãTopophonieNo3_01.aifÒ – ãTopophonieNo3_08.aif
Ò ¥ 8-gliedriger Lautsprecherkreis
Werkangaben und Kommentar
TopoPhonie Nr. 3 (1996)
8-kanalige Raumklangkomposition
fr einen begehbaren RaumklangKrper
Komposition, Produktion, Programmierung,
Rauminszenierung: Sabine Schfer Klangsteuerungstechnik: Sukandar Kartadinata
Auftragswerk des ãWarschauer HerbstÒ
Ausstellungspremiere: 1996 Museum Sztuki Warschau -
Centre for Contemporary Art im Rahmen des ãWarschauer HerbstÒ / 39.
Internationales Festival fr Zeitgenssische Musik Warschau
Werktext:
Die Raumklanginstallation TOPOPHONIE Nr.3 geht aus
dem Raumklangkunst-Projekt TOPOPHONIEN hervor. TOPOPHONIEN sind
computergesteuerte Raumklanginstallationen, bei denen die Lautsprecher im Raum
verteilt sind und eine Matrix bilden, eine Spur, ber die der Klang "in
den Raum gesetzt" bzw. "im Raum bewegt" wird. Neben Tonhhe,
Rhythmus und Klangfarbe tritt hier die rumliche Bewegung des Klangs als
vierter struktureller Parameter hinzu.
Das Raumklangkunst-Projekt ãTopoPhonienÒ von Sabine
Schfer / www.topophonien.de Archivierung der Werke am IMA des ZKM 2007
TopoPhonie Nr. 3 (1996)
Die Raumklanginstallation TOPOPHONIE Nr.3 geht aus
dem Raumklangkunst-Projekt TOPOPHONIEN hervor.
TOPOPHONIEN sind computergesteuerte
Raumklanginstallationen, bei denen die Lautsprecher im Raum verteilt sind und
eine Matrix bilden, eine Spur, ber die der Klang "in den Raum
gesetzt" bzw. "im Raum bewegt" wird. Neben Tonhhe,
Rhythmus und Klangfarbe tritt hier die rumliche
Bewegung des Klangs als vierter struk- tureller Parameter hinzu.
ber das kreisfrmig angeordnete, achtgliedrige
Lautsprecherensemble der TOPOPHONIE Nr.3 bewegen sich Klnge
unterschiedlichster Art. Die wiederkehrenden stringenten kreisfrmigen
Bewegungen wirken wie akustische Markierungen und evozieren Gefhle der
Umzingelung. Klang-Phantasmen bevlkern den Raum und laden ihn mit Qualitten auf.
Elektroakustischer Klang, Instrumentalklang, menschliche Stimmen und Gerusche
sind miteinander verwoben und lassen einen eigentmlichen Sprachcharakter
entstehen, der die Grenzen flie§end werden lsst und sich zwischen den
traditionellen Genres wie elektroakustische Musik, Hrspiel und Musique Concrte
ansiedelt.
----------------------------------------------------------------------------------------
zu 4
Nikolaus Heyduck, Marc Behrens
Plastic / Metal
ÈHyperKult 14Ç
AudioKult und Hypersound?
sthetik und Kultur digitaler
Audiomedien
veranstaltet von der
Fachgruppe ÈComputer als MediumÇ
im Fachbereich ÈInformatik und
GesellschaftÇ der Gesellschaft fr Informatik e.V
Universitt Lneburg
14.-16.7.2005
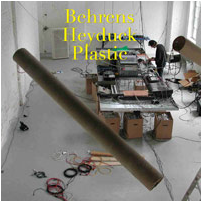

"Plastic
Metal" is a collaboration project by German sound artists Marc Behrens and
Nikolaus Heyduck.
Years
after they first met, Behrens and Heyduck realized that each of them
independently had been working on the same kind of material, such as plastic
bags, bubblewrap, chocolate, medicine, and toy packages.
Heyduck
had made several sound and video installations, Behrens had composed
"Scenes for Contraction" in 1999 (released on his solo CD
"Contraction").
Their
first duo performance with a joined pool of this type of material took place
inside one of Heyduck's installations in the year 2000. For the second
performance they used a box filled with plastic material and an integrated
handheld videocamera equipped with stereo microphones, thus "playing"
the plastic inside...
The
Metal piece was initiated when Heyduck helped to clean Behrens' cellar one day
in 2001. He found two steel drumsets that Behrens had built in 1991 and left to
oxidate in a remote angle.
The
artists decided to reactivate these instruments for another collaborative
project. An extensive recording session and successive digital processing
resulted in the basic material used for two performances in 2002 and 2004.
Both
pieces of this release are products of an evolutionary process - an interaction
of sound recordings and physical objects exposed to a live concert situation,
and further elaboration to create a concise composition in CD format.
Nikolaus
Heyduck is an artist working with audiovisual media since 1978. He studied art
in the 1980s and composition in the early 1990s.
Marc
Behrens is perhaps best classed as a "sound artist", working
internationally across performance, installation, and recorded media (audio and
video).
Wir
dokumentieren eine Aufnahme der Tage fr Neue Musik an der Akademie fr
Tonkunst Darmstadt am18.2.2004.
----------------------------------------------------------------------------------------
zu 6 / 8
CodeCruncher
Rolf Gro§mann, Heiko Idensen, Simon Stockhausen,
Michael Harenberg
CodeCruncher - Multimediaevent 1999
Zwischen Transformation und Kommunikation
Als Number Cruncher gedacht, ist der Computer lngst
zum Code Cruncher gewoden. Der Zahlenfresser, der whrend des 2. Weltkriegs
bereits Codes knackte, nmlich den Verschlsselungscode der deutschen
U-Bootflotte, war ursprnglich zustndig fr die Verarbeitung des techcode, fr
die Kalkulation mathematischer und technischer Zeichen. Auch heute scheint er
nichts anderes zu tun: ein brokratischer Verwalter des unter den multimedialen
Oberflchen floatenden digitalen Codes. Oberflchen, Interfaces und Programme
sind jedoch wie der Computer selbst sedimentierte kulturelle Artefakte. In
ihren konkreten Strukturen und Erscheinungsformen, vollgesogen mit dem cultcode
gesellschaftlich-kultureller Semantik transformieren die Automaten und ihre
Operatoren den kulturellen Code. Bevor die Bitstruktur an die Oberflche des
Apparats zu seinem (Be-)Diener und so zu Information und Bedeutung gelangt,
wird sie von den internen techcodes und cultcodes der Programme transformiert,
variiert, zerstckelt, de- und rekonstruiert.
Dieser Proze§ droht im an Effizienz,
Rationalisierung und Operationalisierung orientierten Diskurs um virtuelle
Lernumgebungen, Datenautobahnen und 'Informations'gesellschaft in den
Hintergrund zu treten. Dass die reine Vernunft der Industriegesellschaft ihren
dialektischen Counterpart mit Irrationalismus und mythischer Verklrung des
Rationalen und Rationellen selbst in sich trgt, ist seit dem brokratisch przisen
Versuch der 'Endlsung' und seit Theodor W. Adornos "Dialektik der Aufklrung"
nichts Neues. Soweit aufgeklrt scheint die Medienwelt vernetzter digitaler
Medien leicht handhabbar. Doch solange das Internet als channel eines personal
TV verkauft wird, solange das Potenzial dieser Medien durch alte Mediengewohnheiten
systematisch verkannt wird, bleiben die hellen und die "dunklen Seiten
ihrer Macht" (Luc Skywalker) jenseits der Wahrnehmbarkeit. Multimedia ist
mehr als das Abrufen informativer Medienschnipsel, reizvolles Homeshopping oder
attraktives computer-based training ... .
Die Performance CodeCruncher ist Experiment, knstlerisch-wissenschaftliches
Sensorium, eine McLuhansche Sonde in rational schwer zugngliches Gebiet. Das
digitale Medium âSchriftÔ liefert Medienmaterial. Digitale Maschinen verschalten
Sinnesebenen auf Programmbefehl. Also befehlen wir. Die "Eigenwelt der
Apparatewelt" (David Dunn) und die Intentionen der menschlichen Operatoren
verschrnken sich zu einer hybriden technokulturellen Einheit.
ÈDas Universum, das andere die Bibliothek nennen,
setzt sich aus einer undefinierten, womglich unendlichen Zahl ineinander
verschachtelter Bildschirme zusammen ...Ç
(Idensen/Krohn, Die imaginre Bibliothek)
Die sprachlichen Codes und Zeichensysteme erfahren
unter den Einwirkungen der Digitalmedien weitreichende Transformationsprozesse:
digital kodiert werden die sprachlichen Zeichen, die ihrerseits schon Trger
von Daten und Informationen, aber auch von poetischen Bildern, metaphorischen
Verdichtungen, Sprachspielen etc. sind, selbst zum ÕInhaltÕ einer fluiden, flchtigen,
abstrakten Re-Mediatisierung, die verschiedene kulturhistorische
Aufschreibesysteme durchluft: In den oralen Kulturen verlassen die Worte als
stimmlicher Hauch den sprechenden Mund, gerinnen dann in der Phase der
Handschrift zur verkrperlichten Schrift-Spur, luten dann als vollends
externalisierte Typen mit der Revolution des Buchdrucks die industrielle
Produktionsweise ein und zirkulieren jetzt in den vernetzten Digitalmedien
vollkommen losgelst von den Mndern, Hnden, menschlichen Sprechwerkzeugen und
Organen als Datenpakete zwischen Servern, Festplatten, Datenbanken,
Bildschirmen, Mailboxen ...
... befreit von materiellen Trgern (wie Stein,
Tafel, Papyrus) verkehren und zirkulieren die Worte im Dokuversum der
Netzwerkkultur nicht nur unabhngig von Sprechern und Autoren ('ohne
Absender'), sondern sogar adressatenlos im Netz - jenseits der klassischen
Trias von Sender-Code-Empfnger, dem Paradigma der Massenkommunikation.
Damit vermischen sich die reinen sprachlichen Codes
(wie sie etwa im ASCII-Code genormt sind) mit Programm-, Sub- und
Metakodierungen (etwa in Markup-Sprachen wie HTML, Perl- und
Java-Programmen...), die wiederum Textstrukturen, Anzeigeformate, aber auch
Querverbindungen, Zugriffs- und Eingriffweisen (etwa Eingabefelder )
generieren.
Der Umgang mit digitalen Texten geht somit ber die
klassische Lektre weit hinaus: Im Dokuversum intertextuell verbundener
Textfragmente und -Segmente wird eine von Literaten (wie Marcel Proust oder
Malarme) ertrumte und mittels poetischer Verfahren innerhalb literarischer
Fiktion simulierte 'aktive Rezeption' mglich, die seitens der
Literaturwissenschaft lediglich fr den Lese-Akt konstatiert worden ist
(Reader-Response, textuelle Leerstelle) oder in creative-writing-Kursen als
Einstieg in Schreibprozessen benutzt wird: In den Momenten des Durchquerens
vernetzter Datenbestnde vollziehen sich Prozesse eines hybriden
'Schreib-Lesens', in denen Operationen des Lese- und Schreibaktes
zusammenfallen.
Solche Mglichkeiten des unmittelbaren Agierens mit
und Eingreifens in Texte ndern die Rolle von AutorInnen und Lesern radikal:
die bergnge zwischen Lesen/Schreiben, Kodieren/Dekodieren werden flie§end und
die Momente der Selektion und der Navigation schreiben sich direkt als Pfade in
die vernetzten Datenbestnde rhizomatische offener Textstruktur ein.
'Schreib-Lesen 'im Internet arbeitet mit dem Zwischenraum der Texte, in den
sich Lesarten, Kommentare, Anmerkungen und Annotationen ebenso einschreiben
wie strukturelle und metatextuelle
Informationscodes (Text- und Verlinkungstrukturen, Zugriffsstatistiken,
Suchmaschinen-Zugriffe). Neue Paradigmen fr das Schreiben und Lesen in
hypermedialen Environments bilden sich erst langsam heraus: Navigieren,
Interagieren, Bild-Schirm-Denken, Chatten ...
Die Gestaltung und Verflssigung der
Schnittstellen/Interfaces digitaler (Hyper-) Texte ist der grundlegende Antrieb
fr die intertextuellen Sprachspiele der Performance CodeCruncher. Sie ist in
mehrdimensionaler Weise textbasiert. Das gilt besonders fr die Verwendung der
akustischen Elemente wie gesprochene Sprache, Sound und Musik. ãTextÒ in Form
von intertextuellen und intermedialen Elementen erscheint in der Performance
auf verschiedenen Ebenen. In CodeCruncher verwendete intertextuelle Elemente knnen
nach semantischen, in bezug auf Sprache und Kommunikation akustischen sowie
(musikalisch-) grammatischen Kriterien unterschieden werden. Transformiert man
alle diese Elemente in neutrale und universell manipulierbare digitale Codes, knnen
sie beliebig bearbeitet, ineinander berfhrt und interaktiv verkoppelt werden.
Es entsteht eine fraktalartige Netzstruktur in Form einer ãHypermedialittÒ im
engeren Sinne, in der jedes Element mit jedem anderen vielfach verbunden, durch
ein anderes ausgelst und/oder dieses steuernd begleitend in Erscheinung treten
kann.
Die Performance selbst kann so als eine Art ãInterfaceÒ
zu dieser Hypermedialitt betrachtet werden, indem die drei ausfhrenden
Akteure interagierend einzelne Elemente herausgreifen und sicht- und hrbar zum
Mittelpunkt des sich ausspinnenden Netzes werden lassen. Die materiellen
Werkzeuge und somit die Instrumente dieses Interfaces sind verschiedene
Computersysteme, welche als Universalmaschinen die digitalen Codes in diesen
Netzen manipulieren. Die Computersysteme werden in der Performance ihrerseits
zu bespielbaren ãHyperinstrumentenÒ, die Bilder, Klnge, Sprache und
Animationen als Ausgangsmaterialien (so wie die Tne eines Klaviers) bereit
stellen und transformieren. Dazu kommen von den ausfhrenden Knstlern live
gesprochene und gespielte Sequenzen, die einerseits in realtime in das
hypermediale Netz eingespeist werden, andererseits auf einer Metaebene bereits
vorhandene Elemente steuern, manipulieren und transformieren. Durch dieses vieldimensionale
knstlerische Spiel mit und in Strukturen, wird der 'harte' digitale Code zum
weichen und flexiblen Medium im Sinne einer wetware - zum 'gecrunchten'
Material.
Im so gecrunchten Code ist ein Bild oder ein Klang
mehr als in seiner bisherigen traditionellen kulturellen Bedeutung/Umgebung.
Bilder und Klnge werden zum flssigen Mediengestalten in virtuellen Rumen,
ausschlie§lich einer ebenso virtuellen Phantasie-Physik gehorchend, sie bewegen
sich durch verschiedene Aggregatszustnde, ihr mediales Erscheinungsbild
entsprechend permanent verndernd.
Das (Schrift-)Bild eines Textes wird zum
abgetasteten Code von gepixelten Schwarz-Wei§-Sequenzen, welche wiederum von
einem algorithmischen Audio-Composer in Klnge umgesetzt, diese abermals
abgetastet in Metainformationen einer Midi-Sequenz, einen synthetischen
Sprachsynthesizer steuern knnten. Das Ganze geht auch andersherum. Oder
ausgehend von einem gesprochenen Wort bis hin zur Graphik, deren digitale
Animation ber die Analyse eines Soundsamples gesteuert wird. Bilder werden zu
Klngen, Klnge zu Steuerinformationen, Steuerinformationen mittels
Sprachsynthesizer zu gesprochener Sprache und diese etwa ber die Steuerung der
Variablen einer fraktalen Gleichung wiederum zu komplexen Grafikanimationen.
Im stndigen Flu§ dieser Transformationsprozesse
bedarf es der menschlichen Intelligenz und knstlerischen Imagination, um die
hier technisch beschriebenen Ablufe, die ja sowohl jedes fr sich als auch in
ihrer erklingenden Gesamtheit immer ebenso Trger von Bedeutung sind, so zu
gestalten und miteinander in Beziehung zu setzen, da§ nicht technische
Verfahren vorgefhrt, sondern knstlerische Formen gestaltet werden. Dabei
kommt auch hier der Kommunikation der Akteure whrend der Performance, dem miteinander
Spielen im Rahmen einer ausgearbeiteten Partitur (wie etwa bei einem
Streich-Trio), das weitgehend ber das fragile Verhltnis von Reaktion und
Improvisation stattfindet, eine zentrale Bedeutung zu.
Ebenso zentral ist das Verhltnis der einzelnen visuell
und akustisch gespielten Elemente im Rahmen des Gesamtablaufs und damit natrlich
auch deren Vorauswahl und Aufbereitung. Ein Sprachsample, welches etwa zur
Steuerung von Grafiken genutzt wird, trgt nach wie vor seinen eigenen
semantischen Charakter. Es kann im Rahmen der Performance sowohl als ãKlangÒ
wie auch als ãInformationÒ gehrt werden. Das Changieren zwischen diesen Ebenen
- sowohl von den Performern als auch von den Rezipienten - schafft ein
besonderes Spannungsverhltnis und l§t die ansonsten rein technischen Vorgnge
(wie bei einem guten Pianisten auch) zum Gegenstand sthetischen Erlebens
werden. Gleichzeitig vermittelt CodeCruncher damit auch eine Ahnung, welches knstlerische
Material in den kleinen Rechenkisten schlummert, wenn sie entsprechend
eingestzt und inmal sinnlich-utopisch anstatt rein rational auf ihre Mglichkeiten
hin befragt werden. Die technische Seite des in CodeCruncher verwendeten
Instrumentariums macht - im Falle des Gelingens - nicht die Knstler zu
Technikern, sondern die Technik - im Sinne Adornos - zu ãkunstfhigem MaterialÒ.
----------------------------------------------------------------------------------------
zu 10
Michael Harenberg & Frank Fiedler
DAS PYTHAGORISCHE KOMMA
konzertante Installation
fr Monochord und Echtzeit-Prozession
Bezogen auf den Ton c wird das Intervall zu His als "pythagorisches
Komma" bezeichnet, ein Frequenzverhltnis von 80/81 oder 1 : 1,01250, das
sich rechnerisch aus der Aufeinanderfolge von 12 Quintschritten ergibt - whrend
bei heutiger Wohltemperierung der Gang durch den Quintenzirkel wieder beim
Ausgangspunkt ankommt.
Pythagoras freute sich, als er an einer Saite (=
mono chorda) zupfend feststellte, da§ die Unterteilung der Saite im "schnen",
das hei§t ganzzahligen Verhltnis auch zum "schnen" Ton fhrte, der
harmonisch eingebunden war in den ganzen Kosmos, in dem diese ganzen Zahlen
alles beherrschen. Die Stellen hinterm Komma regten ihn nicht auf: Der Ton His
kam in der antiken griechischen Musik nicht vor.
Das "pythagorische Komma" bezeichnet die
Lcke, wo der Kreis sich nicht schlie§t, das tragikomische Ende einer
Denkbewegung. Ohne diese wre die Lcke eine Stelle wie jede andre, es gbe nur
Lcken, durch die an allen Ecken und Enden die Mglichkeiten einstrmen wrden,
an die man nicht gedacht hatte bei dem Versuch, einen Kreis zu schlie§en.
Das Monochord heute ist ein 16 - bzw. 30-saitiges
Instrument, wiederholt also den einen Ton, was wiederum auch nie gelingt,
weswegen berhaupt dieser wundersame Obertonreichtum zur Erscheinung kommt, den
Pythagoras auch errechnete, und dessen Unendlichkeit ihm zum Gottesbeweis
wurde. Durch die Live-Elektronik wird dieser Klang zustzlich moduliert und in
den Raum transponiert.
In der konzertanten Installation mit live
electronics spielt das Monochord
selbst die Rolle der "Lcke im System", durch die unvorhergesehne
Ereignisse dieses hybride Instrument aus Holz, Draht und Prozessoren zu immer
neuen Metamorphosen zwingen.
(Das hier gespielte Monochord wurde unter Anleitung
von Bernhard Deutz, Berlin gebaut).
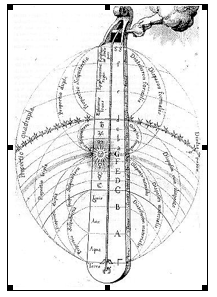
----------------------------------------------------------------------------------------
zu 12:
ãStille PostÒ
2 CD Verffentlichungen des Kompetenzzentrums sthetische
Strategien in Multimedia und digitalen Netzenâ Schwerpunkt Audio an der
Universitt Lneburg 1999 und 2002 unter der Leitung von Dr. Rolf Gro§mann,
Michael Harenberg M.A. und Dr. Martin Warnke.
Wir dokumentieren den Titel ãshellout sessionÒ von
h-peh auf der CD ãStille Post IIÒ.
Die Idee von ãStille PostÒ war eine Remix-Folge
eines vorgegebenen Titels. Der erste Remix wird zum Ausgangsmaterial fr den
nachfolgenden. Die so entstandenen 11 Remixversionen pro CD-Projekt der
Studierenden des ãKompetenzzentrums sthetische StrategienÒ, lassen sich also
auch als eine voranschreitende Remix-Reihe hren, in der das vorhandene
Material fortschreitenden De- und Rekonfigurierungsprozessen unterworfen ist.
Rolf Gro§mann und Michael Harenberg sind mit eigenen Remix-Versionen vertreten.
http://audio.uni-lueneburg.de/lehre-workshops.php#
Stille Post 2
CD-Releaseparty
28.11.2002

"Stille
Post II" versucht spielend zu beleuchten, wie ein Stck im Laufe
verschiedener Remixe immer weiter mutiert und morphiert und schlie§lich ganz
woanders ankommt.
Und
das geht so: Die Teilnehmer remixen sich gegenseitig. Am Anfang steht ein
Ausgangsstck. Der Zweite remixt das Stck des Ersten. Der Dritte remixt das Stck
des zweiten, aber, wie der Name schon suggeriert, NUR in Kenntnis des zweiten
Stcks. Der Vierte remixt das Stck des Dritten ohne die Nummer eins und zwei
zu kennen...usw.
12
Stationen, 12 Wochen, jede Woche entsteht ein weiteres Stck eines weiteren
Produzenten, das dessen ganz individuelle Auffassung eines Remixes
widerspiegelt. Zum Schluss dann eine Listening-Session der besonderen Art: Die
Prsentation eines kompletten Albums, von dem jeder bisher nur zwei Stcke
kennt (nmlich sein eigenes und das des Vormischers). Welche Sounds sind die
hartnckigsten, welche Hooks die langlebigsten, wer nimmt sich welche
Freiheiten raus, welche Stcke prgen die Kette? Entscheidet selbst.
1.
Lawrence - Doxy 100
lawrence
und die alltglichen gefhlsduseleien seiner gerte: verliebt in die tollen grm
tools und das spektral delay und schon fhlt sich der sampler so alleine
gelassen...
[Lawrence
ist Peter Kersten]
2.
Lotto - Paradoxy
Doxy
100 wirkt nicht sedativ. Ist das zu laut geflstert, wenn ich hier sage, dass
Track No1 der Stillen Post2 Spass macht, vor allem die BD am Anfang? Schnen
Dank an Pete fr Flche, Klix, Bass und Melodie. Da muss nichts hinzugefgt
werden, jeder Sound aus "Paradoxy" stammt aus Deiner Feder, nur wo er
steht und mit welchem Pitch, bestimmt meine Maus. Nils, hier jetzt mein Stck,
viel Spass zwo drei vier.
[Lotto
ist Andreas
Otto]
3.
Grabuk - Taxi for Fertile Valleys
Auch
bei meinem Beitrag bleibt die "ich-nehm-alles-aus-der-basis"
Basteltechnik erhalten. Es glockt und flcht wie grabuk halt. Und da 'para' bei
google 'it stop«s' heisst, hlt mein Taxi in den Tlern von Vegas.
[Grabuk
ist Nils
Dittbrenner]
4.
Floating Point - Fertile Ralleys
schmatz,
klick, zergel + ein paar klassische zutaten und schon wted der track vor sich
hin. cultural studies halt, schwerpunkt metronomics.
[Floating
Point ist Rolf Grossmann]
5.
Dr. Markuse - March of the Fertilizers
"Kick,
Punch, it's all in the vibes."
Ein
harmonikoistischer Beitrag zur Beibehaltung der Trackwtung. Cultural Studies
halt, Schwerpunkt: Erlebniswelt Klubkultur.
[Dr.
Markuse ist Markus Engel]
6.
Cromford - En arrire dans le puits de purin
Dr.
Markuse hat den Minimalismus entfhrt. Als Finte muss schnell ein neuer
bereitgestellt werden, um ihn in die Falle zu locken und dingfest zu machen.
[Cromford
ist Timo
Meisel]
7. Sy
Toys - Methane
Flo
schleust durch die Hintertr ein Paar cheesy Melodien ins Studio. Um nicht so
sehr aufzufallen wird das ganze dann mit nettem Geklicker garniert.
[Sy
Toys ist Florian Wendtland]
8.
Atomkunst - Geister, die ich riech
Wir
haben uns an der Jauchegrube rumgetrieben. Verwesung und Fulnis sind nur ein
kleiner Schritt im Kreislauf des Werden und Vergehens. Erdiges Blubbern und
dann noch was gasfrmiges. Atomkunst proudly presents: Geister, die ich riech -
Prayer for the SCSI-Bus Remix.
[Atomkunst
sind Andreas Runte und Sabine Gottfried]
9.
Offbeat Junkies - Ghost Eating Shell
Ein
bisschen phertilizer zum com.post, schon freun sich die hobbygrtner ber das
eigene homegrown - smells like a mean spirit.
[Offbeat
Junkies sind Harm Bremer und Pascal Dreckmann]
10.
H-Peh - Shell-Out Session
Dr.
Dre, Ice T und Ice Cube sagen, wie es luft..sit back and relax !
[H-Peh
ist Hans-Philipp Graf]
11.
Monsieur Noir - Puschelmuschel Motherfucker
le
monsieur liefert mit "puschelmuschel motherfucker" einen der
pointiertesten Beitrge zur aktuellen Gewaltdiskussion und ruft der Nation zu:
Wenn schon schiessen, dann bitte Tore! ...vielleicht macht er aber auch diesmal
einfach nur dufte Tanzmusik...
[Monsieur
Noir ist Oliver Schwarz]
12.
Carl Globus - Pousseur, Pornking
Monsieur
Noir hat seine Klaenge ja kraeftig eingespannt. Alle waren ein bisschen muede.
Also hab ich ihnen ein Holzgitarrenbett gebaut und sie gro§flaechig zugedeckt.
Dort liegen sie jetzt und erzaehlen sich vorm Einschlafen von vergangenen
Taten.
[Carl
Globus ist Tobias Ruderer]
Stille
Post I
Wer
wissen mchte, welchen verwinkelten Verlauf die erste erste Remixkette aus dem
Jahr 2000 genommen hat, kann sie sich hier anhren.
Stille
Post I als Stream und zum Runterladen
Credits:
Idee,
Konzept, Projektleitung und Koordination: Heiko H. Gogolin
Umsetzung
fr glizz.net: Timo Meisel
©2002
sthetische Strategien in Multimedia und Digitalen Netzen (Schwerpunkt Audio)
in Kooperation mit glizz.net
http://www.audio.uni-lueneburg.de/